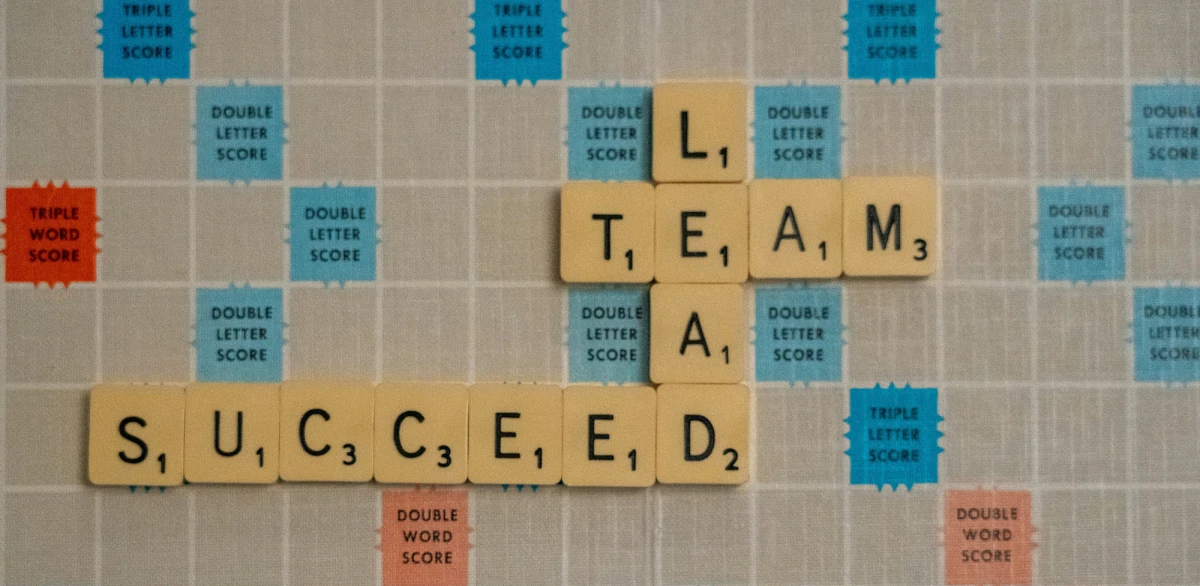Es beeinflusst, wie wir Entscheidungen treffen, Beziehungen gestalten und mit Schwierigkeiten umgehen. Die Entwicklung des Selbstwertgefühls ist ein komplexer, vielschichtiger Prozess, in dem biologische, psychologische und soziale Faktoren zusammenwirken.
Was ist Selbstwertgefühl
Psychologen definieren Selbstwertgefühl als ein System von Vorstellungen über sich selbst, das kognitive (Gedanken), emotionale (Gefühle) und verhaltensbezogene (Handlungen) Komponenten umfasst. Es kann hoch, niedrig oder angemessen (realistisch) sein, was sich direkt auf das psychische Wohlbefinden auswirkt.
Wie entsteht Selbstwertgefühl
1. Die Rolle der Kindheit
Die ersten „Spiegel“ für ein Kind sind Eltern und enge Bezugspersonen. Wenn Eltern Unterstützung und Anerkennung zeigen, wächst das Kind mit einem Gefühl der eigenen Wertigkeit auf. Ständige Kritik oder Ignorieren können dagegen zu geringem Selbstwert führen. Zum Beispiel: Ein Kind, das regelmäßig mit anderen verglichen wird („Schau, wie sehr sich Anna bemüht!“), beginnt oft, sich minderwertig zu fühlen.
2. Das soziale Umfeld
Die Schuljahre und die Jugend verstärken den Einfluss des Umfelds. Lehrer, Freunde und Gleichaltrige formen das Selbstbild. Studien zeigen, dass Jugendliche mit einem unterstützenden Umfeld ein stabileres Selbstwertgefühl entwickeln (PubMed).
3. Persönliche Erfahrungen und Erfolge
Erfolge und Misserfolge hinterlassen tiefe Spuren. Wenn jemand seine Ziele erreicht (z. B. den gewünschten Job bekommt oder ein Studium abschließt), stärkt dies das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Umgekehrt kann eine Serie von Misserfolgen ohne Unterstützung das Selbstvertrauen untergraben.
4. Kultur und Gesellschaft
Auch die Werte der Gesellschaft, in der man lebt, haben Einfluss. In individualistischen Kulturen liegt der Schwerpunkt auf persönlichen Erfolgen und Selbstverwirklichung, in kollektivistischen dagegen auf Harmonie mit anderen und Anerkennung durch die Gruppe. Das erklärt, warum die Maßstäbe für „Erfolg“ von Land zu Land variieren.
5. Genetische und biologische Faktoren
Moderne Forschung zeigt, dass Stressresistenz, Angstniveau und sogar Optimismus eine erbliche Grundlage haben können (NIH). Das bedeutet nicht, dass das Selbstwertgefühl durch Gene vorbestimmt ist, aber die Biologie schafft einen bestimmten Hintergrund.
Hohes und niedriges Selbstwertgefühl: wie es sich zeigt
Hohes Selbstwertgefühl
- Selbstvertrauen ohne den ständigen Drang, den eigenen Wert zu beweisen.
- Fähigkeit, Kritik und Fehler zu akzeptieren, ohne sie als Katastrophe zu sehen.
- Gesunde Grenzen in Beziehungen.
Zum Beispiel nimmt eine Person mit stabilem Selbstwert eine Bemerkung bei der Arbeit als Chance, sich zu verbessern, und nicht als Beweis, dass sie „nichts taugt“.
Niedriges Selbstwertgefühl
- Ständige Selbstzweifel.
- Suche nach Anerkennung und Angst vor Ablehnung.
- Die Neigung, sich ungünstig mit anderen zu vergleichen.
So kann eine Person eine Beförderung ablehnen mit dem Gedanken: „Ich schaffe das sowieso nicht“, obwohl es keine objektiven Gründe dafür gibt (Mayo Clinic).
Wie man ein gesundes Selbstwertgefühl unterstützt
1. Selbstanalyse und Reflexion
Das Führen eines Tagebuchs oder Achtsamkeitsübungen helfen, die eigenen Gedanken zu beobachten und Fakten von Selbstkritik zu trennen.
2. Unterstützendes Umfeld
Der Kontakt mit Menschen, die einen respektieren und wertschätzen, verringert Ängste und stärkt das Vertrauen. Ein toxisches Umfeld dagegen schwächt das Selbstwertgefühl.
3. Realistische Ziele
Es ist wichtig, sich erreichbare Aufgaben zu setzen. Kleine Erfolge summieren sich und schaffen ein Gefühl von Kompetenz.
4. Sorge für den Körper
Körperliche Aktivität, gesunder Schlaf und ausgewogene Ernährung wirken sich positiv auf den emotionalen Zustand und das Selbstvertrauen aus.
Fazit
Das Selbstwertgefühl entsteht aus dem Zusammenspiel innerer und äußerer Faktoren: Familie, Gesellschaft, persönliche Erfahrungen und Biologie. Es ist nicht endgültig festgelegt: Jeder kann daran arbeiten, es zu stärken und eine gesündere Beziehung zu sich selbst aufzubauen. Achtsamkeit, Unterstützung und Respekt vor den eigenen Grenzen spielen dabei eine Schlüsselrolle.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzt nicht die Beratung durch einen Fachmann. Wenn Symptome auftreten, wenden Sie sich bitte an einen Psychologen oder Arzt.