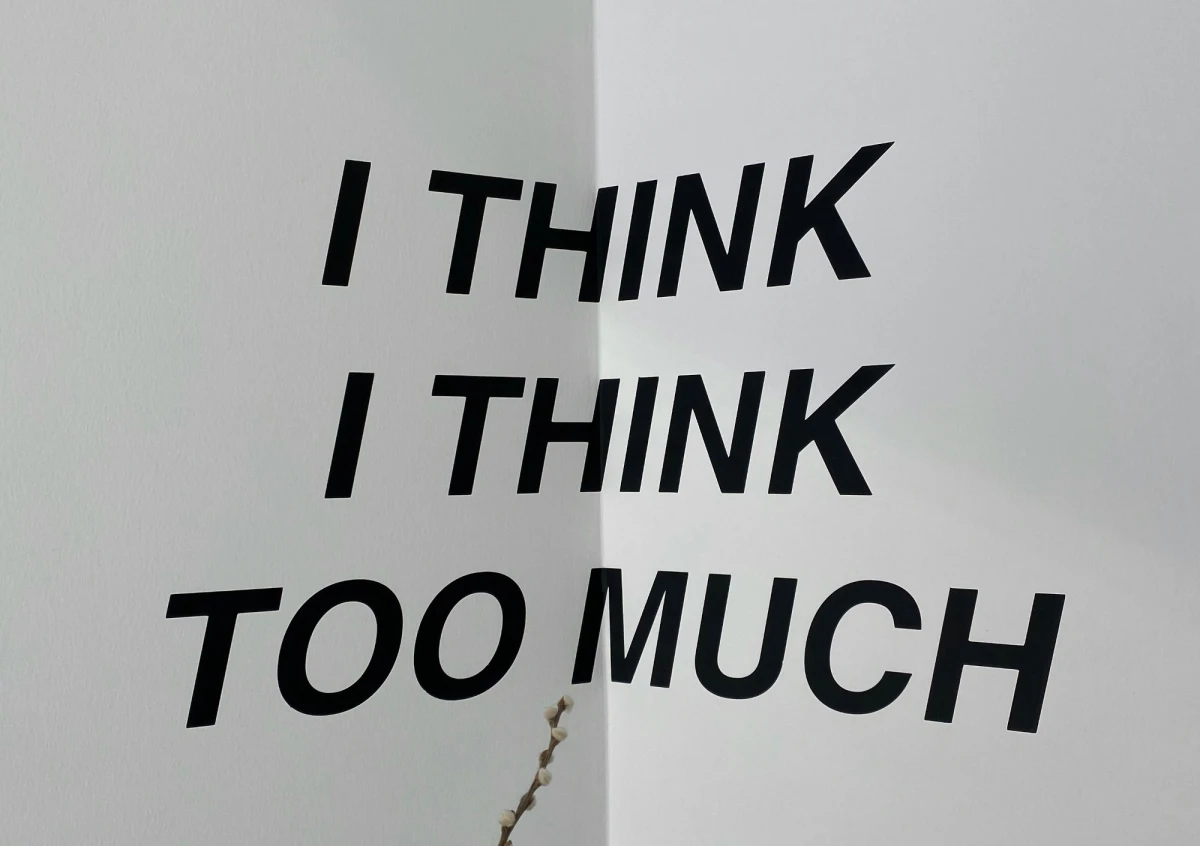Laut Untersuchungen des britischen Psychologen Thomas Curran ist das Niveau des Perfektionismus bei jungen Menschen in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. Dies korreliert mit zunehmender Angst, Depression und Gefühlen der Unzulänglichkeit. Soziale Medien verstärken diesen Trend durch ständige Vergleiche, idealisierte Bilder und Erwartungen an ein perfektes Leben.
Was Curran und seine Kollegen herausfanden
- In einer Meta-Analyse, veröffentlicht im Psychological Bulletin (Curran & Hill, 2019), wurden Daten aus mehr als 164 Stichproben und 41.641 Studierenden in den USA, Kanada und Großbritannien zwischen 1989 und 2016 ausgewertet.
- Die Ergebnisse zeigten einen Anstieg bei drei zentralen Formen des Perfektionismus: self-oriented (hohe persönliche Standards), other-oriented (hohe Erwartungen an andere) und insbesondere socially prescribed perfectionism – das Gefühl, dass Gesellschaft, Gleichaltrige und Eltern Perfektion verlangen.
- Das Gefühl, dass „andere Perfektion von mir erwarten“, nahm stärker zu als die anderen Dimensionen – etwa um ein Drittel im Vergleich zu früheren Generationen.
- Curran betont, dass dieser Anstieg nicht nur ein persönliches oder familiäres Problem ist, sondern kulturelle und soziale Veränderungen widerspiegelt: Wettbewerb, Erfolgsdruck, elterliche Erwartungen und die verstärkte Präsenz sozialer Medien, in denen Schönheits-, Erfolgs- und Lebensideale in idealisierter, oft bearbeiteter Form dargestellt werden.
Wie soziale Medien Gen Z beeinflussen: Mechanismen des Drucks
Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat bieten jungen Menschen Räume zur Selbstdarstellung, in denen Likes, Follower und kuratierte Inhalte wichtige Anerkennungsmetriken darstellen. So verstärken sie Angst und Depression bei Gen Z:
Vergleiche und „perfekte“ Bilder
- Die norwegische „LifeOnSoMe“-Studie (2020–2021) zeigte, dass Jugendliche, die sich stark auf Selbstdarstellung und aufwärtsgerichtete Vergleiche (upward social comparison) konzentrieren, häufiger höhere Perfektionismuswerte und Symptome von Essstörungen aufwiesen.
- Filter, Retusche und kuratierte Inhalte schaffen unerreichbare Standards von Aussehen und Lebensstil – oft vergleichen wir uns nicht mit echten Menschen, sondern mit idealisierten Versionen. Dies erhöht den Druck auf das Selbstwertgefühl.
Der innere Kritiker und die eigenen Ansprüche
- Perfektionismus bedeutet nicht nur Angst vor äußerer Bewertung, sondern auch einen inneren, oft unrealistischen Standard. Das führt zu einem chronischen Gefühl, „nicht genug“ zu sein.
- Die ständige Abhängigkeit von äußerer Bestätigung – Likes, Kommentaren, Followerzahlen – kann Angst auslösen (die Sorge, nicht beachtet, nicht geliked oder abgelehnt zu werden) und depressive Stimmungen verstärken, wenn Erwartungen und Realität nicht übereinstimmen.
Folgen: Wenn der Drang nach Perfektion gefährlich wird
Für viele bedeutet das nicht einfach „besser sein wollen“, sondern ein täglicher Kampf mit sich selbst. Forscher beschreiben folgende Konsequenzen:
- Erhöhte Angst und Stress: die Furcht, „nicht richtig“ zu sein, Angst vor Fehlern und davor, gesellschaftlichen Idealen nicht zu entsprechen.
- Depressive Stimmung: wenn Standards unrealistisch sind, wird Unvollkommenheit als persönliches Versagen erlebt.
- Essstörungen und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper: das Selbstbild durch die Brille fremder Ideale führt oft zu sinkendem Selbstwertgefühl und Versuchen, sich über Diäten, exzessiven Sport oder sogar Operationen anzupassen. Die LifeOnSoMe-Studie zeigt einen Zusammenhang zwischen aufwärtsgerichteten Vergleichen und Essstörungen.
Was man tun kann: Wege der Unterstützung und Veränderung
Perfektionismus ist nicht immer schädlich – hohe Standards können gesund sein, wenn sie mit Flexibilität, Selbstmitgefühl und realistischen Erwartungen kombiniert werden. Wird er jedoch zur dauerhaften Belastung, ist Unterstützung notwendig. Mögliche Schritte sind:
- Kritisches Denken im Umgang mit sozialen Medien fördern: verstehen, dass viele Inhalte gefiltert, inszeniert und bearbeitet sind.
- Unterstützung durch Psychologen und schulische Dienste: Programme integrieren, die Resilienz stärken, Ängste abbauen und mit Perfektionismus arbeiten.
- Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl fördern: lernen, freundlich mit sich selbst umzugehen und Schwächen und Unvollkommenheiten anzuerkennen.
- Kulturelle Erwartungen senken: Eltern, Lehrer und Arbeitgeber können helfen, indem sie nicht nur Ergebnisse, sondern auch Prozesse und Entwicklung wertschätzen.
- Soziale Plattformen könnten Instrumente einführen, die Vergleiche reduzieren: etwa weniger Fokus auf Like-Zahlen und mehr Förderung authentischer, „ungeschönter“ Inhalte. Erste Pilotprojekte testen bereits Modi wie „Realität vs Inspiration“.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt keine professionelle medizinische Beratung. Wenn Sie oder Ihre Angehörigen Symptome von Angst, Depression oder anderen psychischen Problemen erleben, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachkraft.